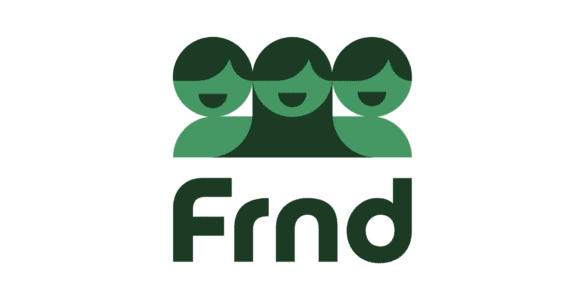In Gesprächen über Depression und andere psychische Erkrankungen begegnet mir immer wieder eine Aussage, die sich hartnäckig hält: „Ich rede nur mit Menschen darüber, die selbst betroffen sind. “ Ganz konkret kommentierte neulich jemand meinen Instagram-Post wie folgt: „Ich rede gar nicht mit Leuten darüber, die es nicht selbst erlebt haben. Sie können, selbst wenn sie es wollen, niemals eine mentale Stütze sein, weil sie eben nicht wissen, wie es dir wirklich geht.“ Diese Haltung ist emotional absolut nachvollziehbar. Rational gesehen ist diese Haltung gefährlich.
Nachfolgend eine kurze Übersicht, worum es in diesem Beitrag geht – Du kannst gerne direkt zu den einzelnen Abschnitten springen, in dem Du sie anklickst:
- Depression – warum eigene Erfahrung verbindet
- Wenn persönliche Erfahrung zur Grenze wird
- Depression erlebt? Und schon Expert:in? – Nicht ganz.
- Depression behandeln ohne selbst betroffen zu sein? – Ja, bitte!
- Angehörige bei Depression: Wertvoll – auch ohne Betroffenheit
- Verstehen kann wachsen – aber nicht mit jedem Menschen
- Unterstützung ist keine Frage der Diagnose
Depression – warum eigene Erfahrung verbindet
Wer selbst eine Depression (oder wahlweise eine andere psychische Erkrankung) erlebt hat, weiß, wie tief diese Erkrankung greifen kann. Sie ist mehr als ein Stimmungstief, mehr als Traurigkeit, mehr als etwas Weltschmerz. Sie kann jede Lebensfreude verschlucken, Motivation auslöschen, Selbstwert zersetzen und selbst einfache Aufgaben unmöglich erscheinen lassen. Dieses Erleben hinterlässt Spuren – und es schafft eine besondere Sensibilität im Umgang mit anderen Betroffenen.
Denn wenn jemand dieselbe Schwere gefühlt hat, braucht es oft weniger Worte. Zwischen den Zeilen entsteht eine Verbindung, getragen von stillem Verstehen. Man muss nicht erklären, wie es sich anfühlt, wenn selbst das Aufstehen am Morgen eine Überwindung ist. Oder wie hilflos man sich fühlt, wenn man die Welt um sich herum nicht mehr greifen kann. Man braucht nicht erklären, warum man trotz Sonnenschein und Urlaub sich innerlich tot fühlt. Dieses geteilte Erleben kann entlastend sein – und heilsam.
In Peer-Gruppen, Selbsthilfeformaten oder im persönlichen Umfeld kann diese Art des Austauschs eine enorme Kraft entfalten. Da ist kein großes Erklären nötig, kein Übersetzen von Gefühlen in Worte, die andere vielleicht sowieso nicht greifen können. Die Worte eines Menschen, der selbst durch diese dunkle Erkrankung gegangen ist, haben oft eine andere Wirkung als jeder gut gemeinte Ratschlag von außen. Nicht, weil sie besser formuliert sind – sondern weil sie aus echtem Erleben sprechen.
Eigene Betroffenheit kann Brücken schlagen. Sie kann Isolation durchbrechen und Trost spenden, gerade dann, wenn es kaum noch möglich erscheint, sich mitzuteilen. Das Gefühl: „Du verstehst mich, weil Du es auch kennst“ – kann eine wertvolle Ressource sein.
Wenn persönliche Erfahrung zur Grenze wird
Wenn wir nur noch denen Raum geben, die selbst betroffen sind, schließen wir ungewollt alle anderen aus – auch jene, die helfen möchten. Wir errichten eine Art unsichtbare Mauer: Auf der einen Seite die, die es „verstehen dürfen“ – weil sie es selbst erlebt haben. Auf der anderen Seite die, die bestenfalls zusehen, schweigen oder sich zurückziehen, weil sie nicht wissen, ob sie überhaupt etwas sagen dürfen.
Diese Haltung entsteht oft aus Enttäuschung – aus all den Momenten, in denen wir uns unverstanden, bevormundet oder belehrt gefühlt haben. Sie ist verständlich. Aber sie birgt auch eine Gefahr: Wir machen Zugehörigkeit von Betroffenheit abhängig.
Das führt dazu, dass Menschen aus unserem Umfeld, die ehrlich unterstützen wollen, verunsichert oder sogar entmutigt werden. Ein Freund, der nie eine Depression hatte, hört vielleicht auf, Fragen zu stellen, weil er Angst hat, „nicht richtig“ zu sein. Eine Partnerin fühlt sich womöglich ohnmächtig, weil alles, was sie sagt, als unqualifiziert wahrgenommen wird – obwohl sie Tag für Tag da ist. Ein Kollege schweigt, obwohl er helfen möchte, weil er spürt, dass er nicht als „richtiges Gegenüber“ gilt.
Und auch für uns Betroffene hat diese Haltung ihren Preis: Denn wer sich nur denen öffnet, die dieselbe Geschichte erzählen können, schließt sich selbst von vielen Möglichkeiten der Unterstützung aus. Wir verpassen Perspektiven, die gerade durch das Anderssein hilfreich wären. Wir entziehen uns Menschen, die uns mit ihrer Stabilität, ihrer Ruhe oder ihrer Außenperspektive hätten gut tun können. Und manchmal führt genau das zu noch mehr Rückzug, zu noch mehr Isolation – obwohl es eigentlich um Verbindung gehen sollte.
Vertrauen darf wachsen – nicht nur dort, wo Erfahrung deckungsgleich ist. Es darf auch da entstehen, wo Menschen den Mut haben, ehrlich zu sagen: „Ich weiß nicht, wie es Dir geht. Aber ich möchte für Dich da sein.“
Und oft ist genau das mehr wert (oder zumindest genauso viel), als jedes „Ich kenn das auch.“
Depression erlebt? Und schon Expert:in? – Nicht ganz.
So wertvoll eigene Betroffenheit im zwischenmenschlichen Kontakt auch ist – sie hat ihre Grenzen. Denn eine erlebte Depression macht niemanden automatisch zur besten Ansprechperson – geschweige denn zur Expertin oder zum Experten für psychische Erkrankungen im Allgemeinen.
Was einem selbst geholfen hat, mag für jemand anderen völlig wirkungslos oder sogar belastend sein. Und genau da passiert es schnell: Man meint es gut, teilt den eigenen Weg – und übersieht dabei, dass man gerade von sich auf andere schließt. Oft ganz unbewusst, mit dem ehrlichen Wunsch, etwas weiterzugeben. Doch gut gemeint ist eben nicht immer gleich gut geeignet.
Gerade ohne fachlichen Hintergrund kann sich der Blick verengen: Die eigene Geschichte wird zur Schablone, die eigene Lösung zur vermeintlichen Antwort auf alles. Doch psychische Erkrankungen sind so individuell wie die Menschen, die sie erleben. Was bei der einen Depression stabilisiert, kann bei einer anderen in Überforderung münden.
Und dann ist da noch etwas, das selten offen ausgesprochen wird: Wer selbst betroffen ist – vielleicht sogar noch mittendrin – trägt ohnehin schon schwer. Sich zusätzlich in das Leid anderer einzufühlen, kann gut gemeint sein, aber auch schnell zur Überforderung führen. Oder zu alten, ungeheilten Wunden zurückführen.
Eigene Betroffenheit kann eine Brücke sein. Aber sie ersetzt weder fachliche Ausbildung noch den achtsamen Umgang mit Grenzen – den eigenen wie den fremden.
Depression behandeln, ohne selbst betroffen zu sein? Ja, bitte!
Immer wieder begegnet mir das unausgesprochene Misstrauen gegenüber Fachpersonen, die keine eigene psychische Erkrankung durchlebt haben. Als müsste ein guter Therapeut selbst einmal depressiv gewesen sein. Oder eine Ärztin könne nur dann glaubwürdig sein, wenn sie selbst mal am Abgrund stand.
Diese Vorstellung ist verständlich – aber sie ist auch verkürzt. Niemand käme auf die Idee, einen Lungenarzt infrage zu stellen, nur weil er selbst kein Asthma hat. Oder eine Onkologin abzulehnen, weil sie selbst keinen Krebs hatte.
Ist nicht das, was zählt, die fachliche Kompetenz, ihre Haltung, ihre Bereitschaft, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen? Und vielleicht auch die Fähigkeit, professionelle Distanz zu halten.
Im Bereich psychischer Erkrankungen wie Depression scheint diese Erwartung verschoben zu sein. Weil die Krankheit unsichtbar ist. Weil sie emotional auflädt. Und weil wir uns manchmal inmitten unserer Verletzlichkeit so sehr danach sehnen, gesehen zu werden – auf eine Weise, die Fachwissen allein nicht immer leisten kann.
Aber genau hier liegt die Stärke vieler Fachpersonen: Sie bringen einen Blick von außen mit. Einen, der nicht durch eigene Trauma-Erfahrungen gefärbt ist. Sie kennen psychische Erkrankungen wie Depression aus der Theorie, aus der Praxis, aus hunderten Gesprächen mit Betroffenen – und genau das ermöglicht ihnen oft eine hilfreiche Klarheit.
Viele Psychotherapeut:innen, Sozialarbeiter:innen, Pflegekräfte oder Kunsttherapeut:innen leisten täglich Großartiges – ohne selbst betroffen zu sein.
Sie hören zu, sie begleiten, sie bleiben. Nicht, weil sie alles nachempfinden können. Sondern, weil sie professionell empathisch handeln können.
Und ganz offen? Ich habe schon andere Betroffene erlebt, die mir erklären wollten, wie ich mein Leben zu leben habe, weil ihnen xyz ja auch half. Und ich habe Fachpersonen erlebt, bei denen ich nach zehn Minuten dachte: „Du hast vielleicht keine Depression, Angststörung oder Trauma erlebt – aber irgendwie findest Du gerade ne Verbindung zu mir, die mich unterstützt.“ (Grüße gehen an dieser Stelle raus an meinen Psychiater und meine ehemalige Therapeutin!)
Empathie ist keine Frage der Diagnose. Sondern der Haltung.
Angehörige bei Depression: Wertvoll – auch ohne Betroffenheit
Oft vergessen wir, dass auch Menschen ohne professionelle Ausbildung oder eigene Erfahrung mit Depression eine wichtige Rolle spielen können – als Partner:in, Freund:in, Kolleg:in oder Familienmitglied. Sie sind keine Therapeut:innen, kein Fachpersonal – und doch können sie etwas leisten, das unersetzlich ist: Da sein. Zuhören. Halt geben.
Und auch wenn es manchmal unbeholfen ist, manchmal holprig – was zählt, ist nicht das perfekte Verhalten, sondern die ehrliche Bereitschaft, dazuzulernen. Niemand wird mit dem Wissen geboren, wie man sich gegenüber einem Menschen mit Depression (oder eben anderen psychischen Erkrankungen) richtig verhält. Und trotzdem gibt es viele, die sich bemühen, sich einfühlen, sich Fragen stellen. Menschen, die nicht „wissen, wie’s ist“, aber wissen wollen, wie es einem geht.
Ich finde, wir sollten genau das sehen – und wertschätzen.
Denn das ist keine Selbstverständlichkeit.
Gerade Angehörige sitzen oft zwischen den Stühlen: Sie wollen helfen, haben aber Angst, etwas falsch zu machen. Sie erleben die Auswirkungen der Erkrankung, ohne sie wirklich greifen zu können. Sie fragen sich, wann sie unterstützen sollen – und wann loslassen. Sie tragen mit – auch wenn sie selbst nicht betroffen sind.
Wir dürfen nicht erwarten, dass Außenstehende uns verstehen, wenn wir ihnen gleichzeitig nicht die Möglichkeit geben, uns kennenzulernen.
Wenn wir uns verschließen, aus Angst, nicht verstanden zu werden, rauben wir anderen die Chance, sich einzufühlen – und uns selbst die Chance, verstanden zu werden.
Was viele nicht-betroffene Menschen mitbringen, ist genau das, was in einer depressiven Krise helfen kann: emotionale Stabilität, Alltagsstruktur, ein Perspektivwechsel. Nicht um zu „retten“ oder „zu reparieren“ – sondern um da zu sein. Als Mensch.
Verstehen kann wachsen – aber nicht mit jedem Menschen
Ich selbst wäre heute nicht mit meinem Partner zusammen, wenn ich damals geglaubt hätte: „Nur, wer selbst betroffen ist, kann mich wirklich verstehen, geschweige denn ich mit ihm eine Beziehung führen.“ Als wir uns vor 15 Jahren kennenlernten, hatte er keinerlei Erfahrung mit psychischen Erkrankungen. Keine eigenen Berührungspunkte, keine vorgefertigten Bilder – und auch keine Angst, zuzugeben, dass er vieles nicht versteht.
Natürlich war das nicht immer leicht. Es gab Unsicherheiten, Verletzlichkeit auf beiden Seiten und viele Tiefs. Aber wir haben uns aufeinander eingelassen. Haben gelernt, miteinander zu sprechen – auch wenn es unbequem war. Nicht nur er hat dazu gelernt, sondern auch ich.
Ich lernte in dieser Beziehung so vieles nach, was viele in ihrer Kindheit lernen: Vertrauen, Grenzen setzen und Grenzen anderer akzeptieren, einen gesunden Umgang mit Konflikten. Das klingt jetzt mehr oder weniger positiv – vieles war auch so – aber in dieser Beziehung habe auch ich Fehler gemacht. In dieser Beziehung habe ich keinesfalls immer alles richtig gemacht (wobei man hier überlegen kann, was immer, alles und richtig bedeuten soll).
Nicht nur (gesunde) Angehörige haben in Beziehungen dazuzulernen, sondern eben oft auch wir Betroffenen.
Marcel, mein Partner, hat sich nie als „Retter“ gesehen oder als jemanden, der mir jetzt helfen muss. Er war und ist jemand, der da ist, zuhört, mitlebt, wenn auch nicht unbedingt mitfühlt. Und genau das hat getragen.
Aber – und das ist mir ebenso wichtig zu sagen – das geht nicht mit jedem Menschen. Wenn ich sage, dass Beziehungen nur wachsen, wenn beide engagiert sind, dann meine ich beide. Betroffene wie Angehörige. Und so, wie es Betroffene gibt, die nicht an sich arbeiten wollen, gibt es eben auch Angehörige, mit denen man reden und reden kann, ohne dass es zu einer Verbesserung der Beziehung führt, geschweige denn zu einer verbindenden Kommunikation.
Auch diese Erfahrung musste ich machen. Mit manchen Freund:innen, Kolleg:innen – und mit meinen Eltern.
Ich habe versucht, mich zu erklären. Mich zu zeigen. Ich wollte, dass sie mich verstehen – oder es zumindest versuchen. Aber es hat nicht funktioniert. Ich werde hier nicht näher darauf eingehen. Zum einen ist diese ganze Geschichte mega komplex, zum anderen habe ich schon die Androhung eines Anwalts erhalten, wenn ich zu sehr darauf eingehe – lassen wir das lieber. Was ich dazu aber sagen kann und möchte ist, dass ich mir mehr Offenheit für meine Lebensrealität gewünscht hätte. Ein offenes Zuhören und Akzeptieren. Ich hätte mir eine Augenhöhe gewünscht, wo wir einen Zugang zueinander finden. Ich hätte mir einen Raum gewünscht, wo wir uns offen begegnen.
Das klingt jetzt vielleicht so weich und nach Gesprächen mit Wattebäuschen. Aber darum ging/geht es mir gar nicht. Sicherlich habe auch ich als Erwachsene Fehler gemacht. Fehler in der Kommunikation bzw. im allgemeinen Beziehungsverhalten. Aber so, wie nicht alles allein an den anderen liegt, liegt eben auch nicht alles an mir. Aufgrund dessen gab es kein Zueinander, sondern ein Auseinander. Ende 2016 sah ich meine Eltern das letzte Mal. Ich habe den Kontakt zu ihnen abgebrochen – nicht leichtfertig, nicht von heut auf morgen, nicht „einfach so“, sondern nach vielen inneren Kämpfen, nach vielen Versuchen, doch noch irgendwie eine Ebene zu finden, auf welcher wir zueinander finden. Die gab es nicht und ich zog die Reißleine. Weil mir immer klarer wurde, dass ich mich selbst verliere, wenn ich weiter versuche, etwas zu erklären, das nicht gehört werden will. Und so hart das auch klingt, aber seitdem ging es mit meiner Genesung bergauf.
Ich musste auf harte Weise lernen, das nicht jede Beziehung, die gut gemeint ist, einen auch gut trägt. Nicht jedes Gegenüber will – oder kann – sich mit dem, was eine Depression (oder eben auch eine andere physische/psychische Erkrankung) bedeutet, ehrlich auseinandersetzen.
Verstehen kann wachsen – aber nur, wenn beide Seiten es wollen. Wenn da eine Basis ist aus Respekt, Offenheit und emotionaler Bewegung. Wenn es kein einseitiges Ziehen ist, sondern ein Miteinander. Wo das gelingt, kann echte Nähe entstehen. Wo das nicht gelingt, darf oder muss man eben loslassen.
Unterstützung ist keine Frage der Diagnose
Empathie ist keine angeborene Fähigkeit, die nur bestimmten Menschen vorbehalten ist – und schon gar nicht nur jenen, die selbst betroffen sind.
Empathie kann erlernt, vertieft und kultiviert werden. Viele Menschen, die keine eigene Erfahrung mit Depression oder anderen psychischen Erkrankungen haben, entwickeln durch Auseinandersetzung, Supervision, Ausbildung – oder schlicht durch menschliche Reife – eine Tiefe im Mitfühlen, die absolut unterstützend wirken kann.
Und umgekehrt: Auch wir Betroffenen tragen Verantwortung. Wenn wir möchten, dass Menschen uns verstehen, unterstützen, da sein können – dann müssen wir ihnen zumindest die Möglichkeit dazu geben.
Das heißt natürlich nicht, dass wir uns jedem Menschen erklären müssen. Oder uns emotional entblößen. Aber pauschal zu sagen, „Nur wer’s kennt, darf mitreden.“, schließt potenzielle Beziehungen aus, lange bevor sie überhaupt entstehen können.
Statt in Kategorien zu denken – betroffen vs. nicht betroffen, richtig vs. falsch – wäre es heilsamer, den Blick auf das zu richten, was wirklich zählt: Offenheit. Lernbereitschaft. Gegenseitiger Respekt. Und die Bereitschaft, auch mal falsch zu liegen – und trotzdem weiter im Gespräch zu bleiben.
Ein sogenannter trialogischer Ansatz – in dem Betroffene, Angehörige und Fachpersonen einander begegnen – kann genau das schaffen: Räume, in denen neue Perspektiven entstehen, Unterstützung sich wandeln darf und niemand für das, was er nicht erlebt hat, ausgeschlossen wird.
In diesem Zusammenhang möchte ich Dir den Beitrag „Selbst betroffen hilft (nicht) am besten“ auf der Website unseres Projekt „Erste Hilfe für die Psyche“ empfehlen. Diesen schrieb Psychologin Lisa Hartmann und beleuchtet darin die Chancen und Grenzen eigener Betroffenheit im professionellen Kontext – differenziert, ehrlich und mit vielen wertvollen Impulsen für alle, die sich mit dem Thema tiefer auseinandersetzen möchten.
Erfahrung kann verbinden – aber sie darf nicht begrenzen.
Gute Unterstützung braucht nicht dieselbe Geschichte, sondern die Bereitschaft, hinzuhören, zu lernen und Unterschiede auszuhalten. Denn Hilfe ist keine Frage der Betroffenheit, sondern der Haltung.