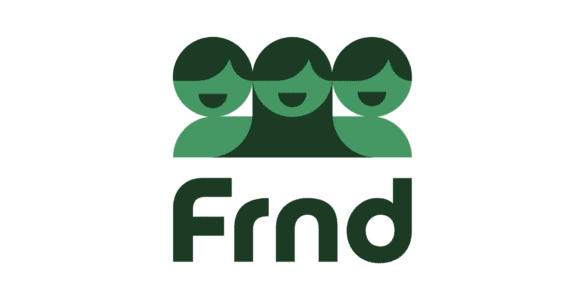Trauer ist das Echo der Liebe, wenn der Mensch fehlt, dem sie galt.
Trauer heißt lieben
April. Der Monat, in dem mein Herz jedes Jahr ein bisschen langsamer schlägt – und gleichzeitig so viel mehr fühlt. Weil sich in diesem Monat so viele Erinnerungen sammeln wie Pützen nach einem Frühlingsregen. Ein Kind, das nie laufen lernte. Eine Oma, die mir insgeheim das Leben rettete. Ein Freund, der zu früh ging.
Drei Herzensmenschen. Drei Abschiede. Drei Narben auf meiner Seele.
Knirps – unser Sternenkind
Ich bin Mama. Auch wenn ich nie ein Kinderzimmer eingerichtet oder Windeln gewechselt habe. Ich bin Mama von Knirps – unserem Sternenkind.
Knirps war nicht geplant, aber sofort willkommen. Als ich das Ultraschallbild zum ersten Mal sah, zögerlich und unsicher durch meine Depression und Angststörung, spürte ich: Da wächst ein kleines Leben in mir. Mein Partner strahlte – seine Sicherheit schenkte mir Mut. Und ja, wir freuten uns. Sehr sogar.
Wir gaben ihm einen Namen – „Knirps“. Einfach so. Wir wussten noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Aber „es“ war ja da – nicht nur irgendein Zellhaufen, sondern unser Kind. Ein Teil von uns. Wir nannten es Knirps. Ich trug ihn 14 Wochen lang in mir, unter meinem Herzen. Wir erzählten ihm Geschichten, gaben ihm Gute-Nacht-Küsse auf meinen Bauch, planten, lachten, träumten. Sein erstes T-Shirt hing bereits in unserer Wohnung. Es war real.
Doch dann kam diese Nacht. Die Stille. Das viele Blut. Ich wusste sofort: Etwas stimmt nicht. Die Klinik, der Ultraschall, die Blicke. Keine Herztöne. Kein Pochpoch mehr. Unser Knirps war tot.
Ich erinnere mich an den Fahrstuhl in den OP. Mein Herz raste, ich begann fast zu hyperventilieren – und die Schwester sagte kalt: „Nun hyperventilisieren Sie mal nicht. Das können wir jetzt hier nicht gebrauchen.“ Ich war schockiert. Verloren. Völlig allein mit meinem Schmerz.
Später erfuhren wir, dass es eine gemeinsame Beisetzung für Sternenkinder gibt. Wir gaben ihm etwas Persönliches mit. Es war tröstlich zu wissen, dass er nicht einfach „entsorgt“ wurde. Und doch – mein Bauch war leer. Mein Herz war es auch.
Was mich tief verletzt, sind die Aussagen von Menschen, die meinen, es sei ja „nur ein Zellhaufen“ gewesen. Dass es kein „richtiges“ Baby war. Dass ich „darüber hinwegkommen müsste“.
Knirps war nicht Nichts. Er war ein Teil von uns. Er war eine Hoffnung. Er war eine Zukunft.
Ich denke sehr oft an ihn. Stelle mir vor, wie er auf einer Wolke mit meiner Oma sitzt, Schoko-Bons nascht und sie beide uns Menschen auf der Erde beobachten.
Das sind meine Bilder. Mein Trost. Meine kleine Welt, die mir hilft, hier unten nicht zu zerbrechen.
Meine Oma – mein Halt im Leben
Meine Oma war der Grund, warum ich noch lebe. Das klingt dramatisch? Vielleicht. Aber es ist wahr. Sie war mein Fels inmitten meines seelischen Sturms, mein Anker in einer Welt, die sich oft viel zu schnell und zu laut drehte.
Sie war da. Gefühlt immer. Still, aber stark. Sie hat nie viele Worte gebraucht, um mir das Gefühl zu geben, dass ich gewollt bin. Gewollt trotz Depression. Trotz Angst. Trotz allem, was ich nicht war – sondern einfach nur wegen dem, was ich war: Ich.
Wenn ich nicht mehr wusste, warum ich eigentlich noch aufstehen soll – dann war da sie. Oft gar nicht mal räumlich – mehr in Gedanken, im Gefühl. Sie war mein Warum. Mein Grund, mein Halt. Mein emotionales Zuhause.
Und dann ging sie. 16 Tage nach Knirps.
Ein zweiter Schlag ins Herz, bevor das erste überhaupt verheilen konnte.
Ich fühlte mich, als hätte man mir das Fundament unter den Füßen weggezogen. Als wäre ich gefallen – und diesmal gäbe es keinen sicheren Schoß mehr, der mich auffängt. Der Tod meiner Oma war kein plötzlicher. Und doch kam er zu früh.
Sie war krank, ja. Aber für mich war sie unersetzlich. Sie war diejenige, die verhindert hat, dass ich mir das Leben nehme.
Das hatte ich ihr versprochen. Damals, mit 15, war ich auf der Beerdigung einer 18-jährigen, die durch Suizid starb. Wir standen am Grab. Es war ein sonniger Tag, doch die Luft war schwer. Die Eltern der Verstorbenen weinten laut, ihre Verzweiflung schnitt sich tief in mein Herz. Und ich fragte mich, wer wohl um mich so doll weinen würde, wäre ich gestorben. Wer würde meine Abwesenheit spüren? Wirklich spüren?
Meine Oma. Sie würde es tun. Und so versprach ich ihr damals, still und heimlich, während wir am Grab standen, dass ich mir nichts antun werde, solange sie lebt.
Dieses Versprechen war nicht einfach nur ein Gedanke. Es wurde zu meinem inneren Anker. Es zwang mich zum Leben – manchmal wortwörtlich. Und als sie starb, fühlte es sich an, als hätte ich dieses Versprechen verloren. Und gleichzeitig wurde mir klar: Ich musste einen neuen Grund finden. Eine neue Art zu leben. Für mich. Nicht mehr nur für sie.
Ich funktionierte nur noch. Lächelte, wenn ich musste. Weinte, wenn keiner hinsah. Und klammerte mich an das Wenige, das mir blieb: Erinnerungen. Ihr Lachen. Ihre Umarmung. Ihre Stimme, die mir im Traum noch manchmal sagt: „Du darfst traurig sein. Und trotzdem weiter Deinen Weg gehen.“
Es hat Jahre gedauert, bis ich mir selbst zugestanden habe: Ich darf trauern. Auch jetzt noch. Auch heute, 13 Jahre später noch. Ich darf meine Oma vermissen. Ohne Erklärungen. Ohne Rechtfertigungen. Ohne Vergleiche.
Denn Trauer hat kein Verfallsdatum – und Liebe auch nicht.
Christian – der Freund, der zum Engel wurde
Christian. Ein Name, der in mir nachhallt. Nicht nur, weil er ein Freund war – sondern weil er einer dieser Menschen war, die wirklich etwas bewegen wollten. Die laut waren, wenn andere schwiegen. Die unbequem waren, weil sie unbequem sein mussten. Weil Wegsehen keine Option war.
Ich lernte ihn Ende 2017 auf dem World Congress of Psychiatry (WPA) kennen. Dort stand er mit seinem Buch „Die Stimme der Übriggebliebenen“ am Verlagsstand. Er erzählte offen von dem, was er erlebt hatte: die Hölle von Ueckermünde, die er als Jugendlicher in den 90ern durchlebte. Seine Geschichte erschütterte mich – und beeindruckte mich gleichzeitig zutiefst. Es war nicht nur Mut, was ich da spürte. Es war eine Art unbändiger Lebenswille, gepaart mit einem klaren Gerechtigkeitssinn und einer Prise Trotz.
Zufällig wohnten wir fast um die Ecke voneinander. Und so trafen wir uns hin und wieder. Mal auf einen Spaziergang im Park, mal in der „Bäckerei“ – so nannte er das Café, in dem wir stundenlang saßen, Kuchen aßen und Leute beobachteten. Ich mochte seine Sicht auf die Welt, seine Eigenheiten, seine Ehrlichkeit. Er war ein toller Mensch, der mich mit seinem unfassbaren Selbstbewusstsein zu pushen versuchte, mich damit in Verlegenheit brachte, doch vor allem auch zum Lachen.
Christian hatte dieses Strahlen in den Augen, wenn er erzählte. Ein Strahlen, das gleichzeitig verletzlich und stark war. Manchmal lachten wir Tränen, manchmal redeten wir über schwere Themen. Über das System, über Psychiatrie, über Trauma.
Es gibt nicht viele gemeinsame Erinnerungen – dafür war unsere Zeit zu kurz. Aber sie war intensiv. Und sie war besonders.
2020 ist Christian durch Suizid gestorben.
Auch heute – Jahre später – bleibt oft nur Stille, wenn ich an ihn denke. Stille, und diese drängende Frage: Warum? Ich weiß, dass es keine einfache Antwort gibt. Und trotzdem will mein Herz sie. Einfach irgendeine Erklärung. Irgendwas.
Was bleibt, ist Erinnerung. Sein Lachen. Seine klare Stimme. Und sein Blick, der manchmal tiefer ging, als mir lieb war. Was bleibt, ist Dankbarkeit, dass ich ihn kennenlernen durfte. Und Trauer, dass er nicht mehr hier ist.
Ich glaube, Christian würde sich freuen, dass ich hier über ihn schreibe. Dass ich nicht schweige. Dass er gesehen wird – so wie er war: unbequem, ehrlich, warmherzig, stark.
Und ich glaube daran, dass es irgendwo ein Wiedersehen gibt …
Trauer ist Liebe, die bleibt
Ich brauche kein weiteres Kind, um ganz zu sein. Ich brauche keine klugen Sätze wie „Die Zeit heilt alle Wunden“. Ich brauche keine Ratschläge, keine Kommentare und schon gar kein „Aber das war doch nur …“
Was ich brauche: Raum. Zeit. Und Respekt.
Denn ich trauere.
Und diese Trauer ist kein Zeichen von Schwäche.
Sie ist Liebe. Liebe, die keinen Platz mehr hat, wohin sie fließen kann. Liebe, die sich in Tränen verwandelt, in Schweigen, in diesem Druck auf der Brust, den ich manchmal nicht loswerde.
Trauer ist laut. Manchmal.
Dann schreit sie in mir, zerreißt mich fast. Wie ein Sturm, der alte Bilder durcheinanderwirbelt.
Und manchmal ist sie leise. Ganz leise.
Wie Hintergrundmusik, die ich kaum höre, aber trotzdem immer da ist. Ein permanentes Echo in mir. Ein Flüstern, das mich daran erinnert, was war. Und wen ich vermisse.
Ich bin Mama. Von Knirps – einem Kind, das nie geboren wurde und mich trotzdem für immer verändert hat.
Ich bin Enkelin. Von einer Oma, die mein Leben hielt, als ich es selbst nicht konnte.
Ich bin Freundin. Von Christian, der so viel für andere bewegte – und am Ende keine Kraft mehr hatte, sich selbst zu halten.
Ich bin Mensch. Mit offenen Wunden und heilen Narben. Mit Gefühlen, die bleiben dürfen. Und das ist genug.
Ich stelle mir vor, wie meine Oma, Knirps und Christian auf einer Wolke sitzen. Christian und Oma stoßen sicherlich hin und wieder mit einem Gläschen Sekt an, während Knirps mit unseren Ratten und Frettchen spielt, die mich in dieser Welt auch schon verließen mussten. Sie lachen zusammen. Vielleicht fliegen sie zusammen durch die Lüfte. Und ich glaube, sie (er-)warten mich. Irgendwann.
Und dieser Gedanke ist vielleicht nicht rational.
Aber er tröstet mich. Und er hält mich hier.
Er lässt mich weiteratmen. Weiterleben. Auf meine Weise.
Trauer braucht einen Platz – mitten im Leben
Was uns oft fehlt, ist nicht Stärke. Sondern Erlaubnis. Erlaubnis, traurig zu sein. Erlaubnis, zu fühlen. Und dabei gesehen zu werden.
Unsere Gesellschaft geht vielen Gefühlen aus dem Weg – besonders der Trauer. Sie gilt als zu schwer, zu viel, zu unpraktisch. Dabei ist sie Teil von uns. Eine Seite der Liebe. Ein Echo der Verbundenheit. Und sie verdient mehr als ein stilles Nebenzimmer.
Statt sie zu übergehen oder zu kaschieren, könnten wir ihr Raum geben. In unseren Gesprächen. In unserem Alltag. In unserem Miteinander. Trauer darf sichtbar sein. Laut oder leise. Zitternd, wütend, leer – ganz egal, wie sie sich zeigt, sie ist echt. Und sie darf sein.
Denn nur, wenn wir sie zulassen, wenn wir sie aussprechen, durchleben, bezeugen – nur dann kann auch unser Leben wieder weicher werden. Ehrlicher. Tragfähiger.
Trauer will nicht überwunden werden. Sie sucht keinen Abschluss. Sie sucht Verbindung. Einen Platz im Leben.
Und diesen Platz dürfen wir ihr geben. Für uns. Für die, die fehlen. Für die, die lieben.