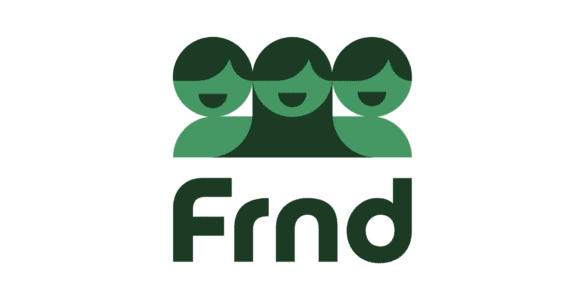Unlängst las ich in einem Artikel über Depressionen, dass ein Klinikaufenthalt wie ein Urlaub sei. Nun, ich selbst war dreimal für je acht Wochen in einer Tagesklinik. Die Tagesklinik ist ein teilstationärer Aufenthalt, d.h., ich bin morgens hingegangen, durchlief verschiedene Therapie-Einheiten und bin nachmittags bzw. über Nacht zu Hause gewesen. Nachfolgend berichte ich von meinen Erfahrungen, warum ich dort war, wie und ob es mir geholfen hat – und vor allem, warum das ganze KEIN Urlaub ist.
Die Zeit vor meinem ersten Tagesklinikaufenthalt
Dezember 2011: Außer, dass ich traurig, in vielen Dingen hoffnungslos und oftmals mit mir und meinem Leben überfordert war, wusste ich zunächst gar nicht, was mein eigentliches Problem ist. Ich habe nicht verstanden, warum es mir schlecht ging.
Es bestanden für mich starke familiäre Probleme, deren Konfliktlösung mir hoffnungslos erschienen und mit welchen ich nahezu ständig konfrontiert wurde. Selbst andere belastende Situationen aus der Vergangenheit, welche temporär abgeschlossen waren, zogen sich immer wieder in meine Gegenwart, oftmals durch nächtliche Träume.
Zudem hatte ich enorme Schlafprobleme und spürte eine nahezu ständige Angespanntheit, emotionaler Stress lief von Null auf Hundert, war erschöpft und konnte mich kaum auf eine Sache konzentrieren (z. B. ein Buch lesen).
Ich fühlte mich leer, hoffnungslos, ziemlich verzweifelt, unsagbar traurig und nahezu permanent niedergeschlagen. Mit meinen Gedanken war ich immer öfter in einen Strudel geraten, bei welchem ich keinen Ausweg fand, wodurch ich häufig an den Tod dachte, als Erlösung aus meinem Chaos und für mich lebensunwerten Leben.
Der Aufnahmetermin in der Tagesklinik rückte immer näher und ich habe meine Entscheidung dort hinzugehen, nahezu täglich in Frage gestellt. Ist es der richtige Weg? Woher weiß ich, dass es die richtige Entscheidung ist? Können sie mir dort helfen? Was ist, wenn es nichts bringt – wie geht es dann weiter?
Eine Antwort über die Richtigkeit meiner Entscheidung werde ich nur dann erhalten, wenn ich es ausprobiere. Klingt wahnsinnig logisch, doch machte mir diese Entscheidung auch Angst. Ich war diejenige, die das für sich entscheiden musste, ich musste Verantwortung für mich übernehmen – was ist, wenn es nichts bringt?
Letzten Endes bestand ein großer Teil der Angst darin, dass ich mir eingestehen musste, dass ich Hilfe benötige – intensivere Hilfe, als eine ambulante Therapeutin leisten kann.
Am Anfang war da nur Abwehrhaltung und Skepsis
Also kam der erste Tag und auf meinem „Stundenplan“ standen verschiedene Therapie-Einheiten wie z. B. Sport, Entspannungsübungen, Kunst- und Ergotherapie, Einzel- und Gruppengespräche und zweimal die Woche eine Gemeinschaftsaktivität. Wenn man das so liest, dann klingt das wohl wirklich nicht nach harter Arbeit, oder?
Also, ich habe zunächst nicht verstanden, warum ich ein Bild malen oder an einem Speckstein feilen soll. Und warum muss es zweimal die Woche eine Gemeinschaftsaktivität geben? Ich bin doch nicht hier, um mit anderen Menschen einen Kaffee trinken zu gehen oder ein Museum zu besuchen. Ich möchte doch an mir und meiner Traurigkeit und Verzweiflung arbeiten. Und Sport? Na, dass ist ja überhaupt das schlimmste …
Ich verstand die Therapie-Einheiten nicht und hatte erstmal eine Abwehrhaltung eingenommen. Zum Glück gibt es die Einzelgespräche – von denen hatte ich mir am meisten erhofft.
Jeder Tag begann mit einer Morgenrunde
Jeden Morgen trafen wir Patient:innen und einige Mitarbeiter:innen der Klinik uns im Gruppenraum zur Morgenrunde. In welcher Stimmung bin ich da? Wie habe ich meinen gestrigen Abend verbracht? Und was ist mir heute schon schönes aufgefallen? Das waren die drei Standardfragen am Morgen.
Angespannt und nervös saß ich jedes Mal da … vor etwa 30 Leuten musste ich jetzt sagen, wie es mir geht … dabei weiß ich das selbst ja nicht so genau …
Welche Worte finde ich, um das, was ich (nicht) fühle, ausdrücken zu können?
Das war der Hintergrund der Morgenrunde – in sich reinhören: Was fühle ich gerade? Sich dessen bewusst machen, was jetzt in dem Moment in einem vorgeht. Und zugleich auch den Blick schärfen, was schönes passiert ist. Sei es das Zwitschern der Vögel, der freundliche Busfahrer oder das es einen schönen Sonnenaufgang gab.
Das mag banal klingen, doch wenn man depressiv ist, dann ist der Blick getrübt von allen Problemen und Ängsten. Doch wie oft sind es die Kleinigkeiten, die uns ein kurzes Lächeln ins Gesicht zaubern? Das müssen Menschen mit Depressionen (…) lernen – dass es noch schönes um uns herum gibt!

Was ich gerne schon vor meinen Therapien und dem Aufenthalt in der Tagesklinik gewusst hätte …
Hier bekommst Du nicht nur eine Ladung Wissen, sondern auch jede Menge praktische Tipps, die Du direkt im Alltag anwenden kannst. Die Selbsthilfemethoden sind aus den Bereichen Resilienz, Achtsamkeit, Selbstmitgefühl und Imagination. Mit diesen Übungen weckst Du Deine inneren Ressourcen und gehst gestärkt durch den Alltag.
Mein Ziel ist es, dass Du nicht nur die fachlichen Grundlagen zur Selbstfürsorge und Selbsthilfe lernst, sondern auch herausfindest, wo Deine persönlichen Hindernisse liegen.
Der Online-Kurs hilft Dir zu verstehen, was Akzeptanz wirklich bedeutet und wie Du damit Deine Gefühle besser managen kannst. Und ab und zu gibt’s auch ein paar persönliche Einblicke von mir, um Dich noch besser zu unterstützen.
Und ich lernte, in mich reinzuhören, ich versuchte Worte zu finden für das, was mir unaussprechbar erschien. Ich lernte, dass ich sagen darf, dass es mir schlecht geht. Ich konnte und durfte in der Klinik mit all meinen Gefühlen sein, wie ich eben bin. Ohne mich verstecken zu müssen.
Ich habe gelernt, nach und nach meine Maske fallen zu lassen und ich selbst zu sein!
Ergotherapie ist mehr als Körbe flechten
Wer unter Depressionen leidet, der befindet sich oftmals mit seinem Umfeld und sich selbst im Chaos. Unstrukturiert und unorganisiert verliefen auch meine Tage. Oftmals fehlte mir die Kraft und der Antrieb aufzustehen, den Haushalt in Ordnung zu halten, mich zu konzentrieren oder der Mut, mich mit etwas Neuem zu beschäftigen.
In der Ergotherapie geht es um solche basalen Dinge. Ob es nun die Arbeit mit Ton, Speckstein oder das Stricken ist – in der Therapieeinheit konzentriere ich mich einzig und allein auf mein Projekt.
Ich habe noch nie mit Ton gearbeitet? Ich traue es mir nicht zu? Dann wird es in der Ergotherapie dafür Zeit und Raum geben. Oftmals ist auch das ein Kampf. Mein Tonprojekt sieht vielleicht nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Schnell schleichen sich dadurch wieder Selbstzweifel ein, welche es gilt rauszulassen und zu bekämpfen. Und wenn das Werk fertig ist, dann habe ich etwas geschafft. Ich ganz alleine!
Es sind die kleinen Erfolgserlebnisse, die zählen. Es muss aus Ton nicht die schönste Vase werden. Doch gerade, wenn ich mir nichts zutraue und voller Selbstzweifeln bin, weil ich ja gar nichts kann – dann ist so ein Erfolgserlebnis eine hilfreiche Erfahrung, sich doch auch mal in unbekanntes Terrain zu begeben. Und manchmal hat das Werk aus Ton oder Speckstein mehr mit einem zu tun, als man anfangs dachte. Unter folgendem Beitrag ist mehr dazu zu lesen: Wie mein Speckstein mir hilft, mich mehr wertzuschätzen.
Das liest sich wahrscheinlich einfach, doch wenn Du Dich selbst die ganze Zeit kritisierst und vorwirfst, was Du doch alles nicht kannst, wenn Du Dir nichts zutraust und keine Kraft verspürst, irgendwas zu tun – dann ist das mehr als anstrengend, zermürbend und demotivierend. Es gleicht einem Kampf mit sich selbst, wie die zwei Wölfe in Dir, die beide überleben wollen.
Zudem kann man auch anhand der Ergotherapie an seinem „Thema“, seinem Problem arbeiten. Ich habe für zwei Verstorbene aus Ton jeweils einen Stern geformt und bemalt. Das war mein Beginn, mich mit meiner Trauer auseinander zusetzen und Abschied zu nehmen. Beide Sterne sollten noch auf die jeweiligen Gräber kommen – doch offen gesagt liegen sie nun seit neun Jahren gut verpackt im Schrank. Neun Jahre … so lange ist mein letzter Aufenthalt in der Tagesklinik schon her …
Nun okay, die Sterne liegen noch hier. An den Gräbern war ich seitdem nicht. „Soweit“ bin ich noch nicht nicht, als das ich da einfach mal so hingehen könnte. Aber das ist ein anderes Thema.
Doch dies ist ein Beispiel, wie schmerzhaft auch die Ergotherapie sein kann. Für mich war es enorm schwer, die Trauergefühle zuzulassen. Ich habe die Gefühle dazu einige Jahre verdrängt und wollte mich nicht damit auseinandersetzen. In der Ergotherapie fand ich durch die Arbeit am Speckstein einen Zugang zu ihnen.
Frei nach dem Motto „Die Zeit heilt alle Wunden“ hatte ich gehofft, ich würde irgendwann mit meinem Schmerz umgehen können. Doch der Spruch ist unvollständig – nur wenn wir mit der Zeit etwas anfangen, können die Wunden heilen.
Damit habe ich in der Ergotherapie angefangen und nach und nach kam meine Trauer und meine Sehnsucht nach den Verstorbenen ans Tageslicht. Jeder Mensch, der schon mal einen geliebten Menschen verloren hat weiß, dass sich sowas nun wirklich nicht wie Urlaub anfühlt!
Ein anderes Thema, was ich in der Ergotherapie anging, war fehlende Liebe und Geborgenheit, die ich mir gerne familiär gewünscht hätte. Hierzu lernte ich stricken und es entstand ein Schal mit Kapuze. Das war ganz schön ein Kampf … innerlich wie äußerlich. Aber es war ein total spannender Prozess, vor allem im Nachhinein betrachtet.
Ich entwarf etwas für mich ganz allein, etwas, was mir Wärme schenkt und kuschelig ist. Es war ein Schritt dahin, dass ich mir – auf ganz unterschiedlichen Ebenen – selbst Wärme, Geborgenheit und Liebe schenken kann. Okay, Liebe bzw. Selbstliebe ist da ein ziemlich großes Wort, aber Wärme und Geborgenheit, das fühlte sich für mich stimmig an.
Den Schal habe ich natürlich immer noch, auch wenn ich ihn nie trug. Dafür war er mir bis dato zu „themenlastig“. Aber wer weiß, was noch kommt …
HIER im Teil 2 geht es mit Kunsttherapie, Imaginationsübungen und den bunten Nachmittagen weiter geht – und auch der Frage, ob ich nach dem Aufenthalt in der Tagesklinik gesund war …